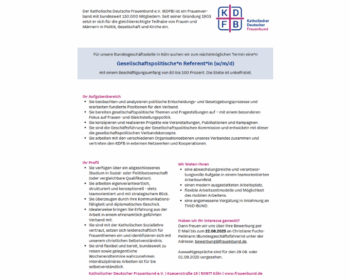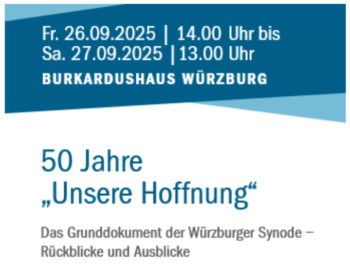Save the date: Berliner Werkstattgespräch 2026
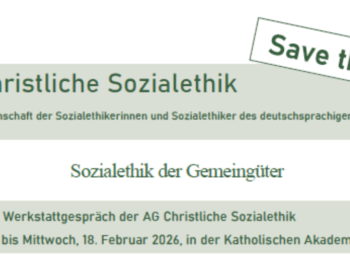
Das nächste Werkstattgespräch der AG Christliche Sozialethik findet von 16. bis 18. Februar 2026 in der Katholischen Akademie Berlin statt. Das Thema der Tagung lautet „Sozialethik der Gemeingüter“. Die Arbeitsgemeinschaft wird sich in der Tagung mit der Aushandlung, Herstellung, Bereitstellung und Nutzung von Gemeingütern beschäftigen. Mit ›Gemeingütern‹ werden all diejenigen Sachgüter und Dienstleistungen gemeint, die – nach gesellschaftlicher und zumeist politisch ausgehandelter Übereinkunft – allen zur Verfügung stehen sollen. Sie werden deswegen, wenigstens teilweise, der privatwirtschaftlichen Produktionsweise entzogen und in unterschiedlicher Weise gemeinwirtschaftlich, häufig unter staatlicher Kontrolle, her- und bereitgestellt. Auf dem Werkstattgespräch wird gefragt, ob, in welcher Hinsicht und in welchem Umfang Gemeingüter zur gerechten Ordnung moderner Gesellschaften gehören – und wie diese bewirtschaftet werden müssen, um diese gerecht ›zu machen‹. Über einen Call for Papers für Nachwuchwissenschaftler:innen werden diese eingeladen, ihre laufenden oder abgeschlossenen Projekte, aber auch außerhalb ihrer Projekte entstandenen Überlegungen zur ›Sozialethik der Gemeingüter‹ in einem offenen Panel vorzustellen. Zum ausführlichen Save the date als PDF. Zum Call for Papers für Nachwuchwissenschaftler:innen.